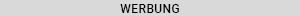Das Gesundheitswesen wurde während der akuten Phase der Corona-Pandemie besonders gefordert. Dr. Jürg Lareida, Präsident des Aargauischen Ärzteverbandes, zieht Bilanz und spricht über den neuen Praxisalltag, die Digitalisierung in den Arztpraxen sowie eine Hausarztmedizin, die immer wichtiger wird.

Die Ärzte und das gesamte Personal im Gesundheitswesen wurden in der Corona-Krise stark beansprucht. Was waren oder sind die grössten Herausforderungen?
Jürg Lareida: Die Belastung der Strukturen im Gesundheitswesen durch die Coronavirus-Infektionen muss differenziert betrachtet werden. Im Spital wurden insbesondere die Intensivstationen und die Anästhesie mit Covid-Patienten belastet, während gleichzeitig ganze Abteilungen der Chirurgie schliessen mussten. Beatmete Patienten sind sehr aufwändig und benötigen viel Personal und technische Apparate. Dann ist das Krankheitsbild an sich sehr belastend. Die an Covid-19 schwer erkrankten Menschen leiden unter dramatischer Atemnot. Dieser Zustand ist auch für das betreuende Personal nur schwer zu ertragen. Ein grosses Problem für die Spitäler war abzuschätzen, wie gross der Bedarf an Intensivplätzen sein würde. Um eine Überlastung der Intensivstationen – wie in Norditalien und den USA – zu vermeiden wurden die Kapazitäten ausgebaut. Da Intensivpflegepersonal nicht einfach so rekrutiert werden kann (Bedienung der technisch anspruchsvollen Apparaturen) musste das Anästhesiepersonal herangezogen werden. Als Konsequenz konnten die Operationssäle nicht mehr betrieben werden. Im Kanton Aargau mussten dank der Tatsache, dass in den Alters- und Pflegeeinrichtungen nur wenige Bewohner angesteckt wurden, die vorhandenen Kapazitäten glücklicherweise nicht ausgereizt werden.
Wie hat sich der Alltag aufgrund von Corona in der Arztpraxis verändert?
Die ambulante Medizin hatte auf Geheiss des Bundes weitgehend stillzustehen. Dies führte dazu, dass die Praxen ihren Betrieb stark reduzieren oder sogar vorübergehend schliessen mussten. Der Praxisalltag ist nach dem Lockdown aufwändiger geworden, die Planung der Sprechstunde muss präziser gestaltet werden. Die Praxen mussten ihre Infrastruktur umstellen, infektiöse Patienten gesondert behandeln, und verhindern, dass die Praxen zu Infektionsherden wurden. Dazu gehört, dass, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, Masken und Schutzkleidung getragen werden müssen. Andererseits werden die Praxen viel häufiger gereinigt und desinfiziert. Viele Patienten haben trotzdem heute noch unbegründete Bedenken, sie könnten sich in der Arztpraxis anstecken. Dies wird durch unsere Schutzmassnahmen verhindert.
Die Pandemie führt zu hohen Mehrkosten im Gesundheitswesen, die Rechnung für die Versicherten wird happig ausfallen: das klingt einleuchtend, ist aber falsch. Wie sehen Sie das?
Es ist bisher unklar, welche Kosten zusätzlich entstehen. Die Kassen werden aktuell nicht übermässig belastet. Im Gegenteil, es wurden März/April/Mai massiv weniger medizinische Leistungen sowohl in den Spitälern wie den Praxen (bis zu 70 Prozent Umsatzeinbruch!) erbracht, was die Prämienzahler entlasten sollte. Allerdings werden die PCR-Tests und eine allfällige Impfung in Zukunft auch ins Gewicht fallen. Die Situation muss genau beobachtet und analysiert werden. Hier helfen unsere Datenpools.
Die Schweiz hat heute schon eine der höchsten Ärztedichte der Welt. Allerdings haben wir einen Hausarztmangel. Wie denn das?
Das Problem ist komplex. Wir leben in einem der Länder mit dem weltweit höchsten Lebensstandard. Die Lebenserwartung ist in der Schweiz weltweit am höchsten. Wohlstand fördert den Wunsch nach ewiger Gesundheit. Dies führt dazu, dass das Gesundheitswesen stark ausgebaut wurde und heute 30 Prozent des Bruttoinlandproduktes ausmacht. Ein Hausarzt arbeitet heute deutlich weniger lang als früher. In den letzten 30 Jahren nahm der Anteil der Frauen in der Medizin stark zu. Heute ist die Mehrheit der Medizinstudenten weiblich. Obwohl dies sehr zu begrüssen ist, entstehen dadurch auch Nebeneffekte. Frauen können naturbedingt oft nicht zu 100 Prozent in einer Arztpraxis arbeiten. So werden insgesamt mehr Ärztinnen und Ärzte benötigt. Ein weiteres grosses Problem stellt die Attraktivität der Spezialität dar. Solange die Arbeitsbedingungen in gewissen Spezialdisziplinen und auch den Spitälern viel besser sind als in der Hausarztmedizin, werden viele Ärzte sich in den lukrativeren Gebieten ausbilden. Sie fehlen dann in der Hausarztpraxis. Mehr Ärzte auszubilden hilft da nicht.
Hat der klassische Hausarzt bald ausgedient oder wieso wollen junge Ärzte oftmals keine Hausarztpraxis führen?
Nein, die Hausarztmedizin wird immer wichtiger, aber die Attraktivität muss dringend gesteigert werden. Dies betrifft nicht nur den Tarif, der unbedingt verbessert werden muss, sondern auch die massiv gestiegene Administration und die zunehmende Bevormundung durch Kassen und Staat. Zudem werden die Ärzte von Politik und Kassen immer wieder als Hauptschuldige für die steigenden Gesundheitskosten angeprangert. Niemand ist bereit die wirklichen Ursachen zu diskutieren und anzugehen. Dies ist perfid, im Grundsatz falsch und muss aufhören!
Die junge Generation von Ärzten legt mehr Wert auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, kaum jemand ist bereit, in der eigenen Praxis oder als Angestellte 60 Stunden pro Woche zu arbeiten wie manch ein traditioneller Arzt. Wie hat sich der Beruf des Arztes gewandelt?
Das ist genau ein Teil des Problems. 60-80 Stunden pro Woche arbeiten ist für junge Ärztinnen und Ärzte zu Recht nicht attraktiv, insbesondere wenn die Entlöhnung nicht stimmt.
Gemeinschaftspraxen sind voll im Trend. Bewährt sich dieses Modell?
Auf jeden Fall. Da sind flexiblere Arbeitszeiten möglich und die Betriebskosten können geteilt werden. Die jungen Ärzte lassen sich für solche Modelle gewinnen.
Heillos überlastete Ärzte und geschlossene Praxen: ein Schreckensszenario für viele Patienten. Laut den Krankenkassen besteht jedoch vielmehr Gefahr, dass es zu einer Überversorgung mit Mediziner kommt. Stimmt das?
Die Situation muss wiederum differenziert betrachtet werden. Natürlich bestimmt auch in der Medizin das Angebot die Nachfrage. Allerdings steigen auch die Bedürfnisse der Bevölkerung. Während in der Hausarztmedizin und gewissen nicht invasiven Spezialdisziplinen ein grosser Mangel besteht, gibt es durchaus ein Überangebot in anderen Bereichen. Hinzu kommt, dass in den nächsten Jahren viele Ärzte, die hohe Pensen arbeiten, pensioniert werden. Sich alleine auf die Zahl der Mediziner zu beziehen, wird dem Problem nicht gerecht.
Das Gesundheitswesen wird mehr und mehr zum Selbstbedienungsladen. Immer besser und immer mehr, lautet die Erwartung. Das kann nicht immer so weitergehen, oder?
Das Hausarztmodell gibt hier Gegensteuer. Dort kann gesteuert werden. Unnötig Untersuchungen oder Behandlungen können verhindert werden. Dies führt zu Einschränkungen. Wenn wir alles haben wollen, müssen wir auch entsprechend dafür bezahlen. Da helfen auch Kostenbegrenzungsinitiativen nichts. Im Gegenteil, die Zweiklassenmedizin wird dadurch gefördert. Die Meinung, dass Sparen ohne Abstriche möglich ist, gilt auch im Gesundheitswesen nicht. Die Defizite in der aktuellen Corona-Pandemie, wie das fehlende Schutzmaterial, die Auslagerung der Produktion wichtiger Medikamente etc., zeigen deutlich auf, was passiert, wenn nur ans Geld gedacht wird.
Die Diskussion um die Finanzierbarkeit des Gesundheitswesens werden halbherzig geführt, weil zu viele zu gut vom System leben. Was braucht es, um den gordischen Knoten durchzuhauen?
Wenn ich die Lösung hätte, würde ich sie sofort umsetzen. Eine gewisse Steuerung ist unumgänglich. Allerdings müssen Qualitätskriterien im Vordergrund stehen und nicht einfach der Geldhahn zugedreht werden. Wer nur spart, vernichtet Qualität, wer die Qualität steigert, spart Geld. FMH und Fachgesellschaften arbeiten seit Jahren an Qualitätsprogrammen.
Wie können Qualität der medizinischen Versorgung und die Zugänglichkeit zu den Leistungen gesichert werden?
Alle Fachgesellschaften entwickeln Qualitätsprogramme. In den chirurgischen Fachgebieten wird das Augenmerk auf die Indikationsqualität gelegt. Es entstehen in allen Fachgebieten immer neue Guidelines, die die Behandlung erleichtern und verbessern. Sicherlich nicht hilfreich sind irgendwelche Messwerte, da die Medizin individuell ist und kein Mensch gleich wie der andere sein kann. Auch problematisch sind die Fallzahlen. Diese haben mit Qualität nicht viel zu tun.
Digitalisierung, personalisierte Medizin usw. sind grosse Themen: Mehr Chancen oder Risiken?
Die Digitalisierung ist in den Arztpraxen entgegen anderslautenden Berichten weit fortgeschritten. Ob das heute angedachte elektronische Patientendossier jedoch das Ei des Kolumbus darstellt, bezweifle ich stark. So wichtig ein solches Dossier ist, so veraltet ist die Struktur, die nun eingeführt werden soll. Angesichts der grossen Probleme wäre ein Marschhalt notwendig, um die Problematik mit heute möglichen Lösungen zu beleuchten. Die personalisierte Medizin ist ein Versprechen für die Zukunft, da Therapien sicherer gemacht werden können. Dass damit aber Kosten gespart werden können ist eine Illusion.
Was wünsche Sie sich persönlich für Ihren Berufsstand?
Dass die Medizin weiterhin frei praktiziert werden kann, und auch in Zukunft vielen Patienten ohne Zweiklassenmedizin geholfen werden kann.
Interview: Corinne Remund
Aargauischer Ärzteverband
Der Aargauische Ärzteverband findet seinen Ursprung vor 200 Jahren. Damals haben sich einige Mediziner zusammengeschlossen, insbesondere um die Fortbildung zu organisieren. Heute zählt der Verband rund 1700 Mitglieder. Die grössten Herausforderungen für die Mitglieder sind die sinkende Kaufkraft, Zunahme der Administration, fehlende Nachfolge sowie staatliche Eingriffe.